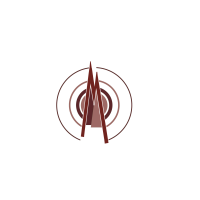Bericht zur Tagung 2013 des Instituts für Rundfunkrecht
„Urhebervertragsrecht – Gelungen oder reformbedürftig?“ - 47. Tagung des Instituts für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Eigentum am 27.05.2013
Auch eine schlechte Reform kann Gutes hervorbringen
Am 27. Mai 2013 hatte das Institut für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln zu seiner 47. Tagung unter dem Thema „Urhebervertragsrecht – Gelungen oder reformbedürftig?“ geladen. Die Veranstaltung tagte im Deutschlandfunk Kammermusiksaal des Deutschlandradios Köln, – geradezu sinnbildlich dort, wo Kreativität tagtäglich gelebt, inszeniert und dargeboten wird. Wie in diesem Saal in musikalischer Hinsicht sowohl Harmonie als auch gelegentlich Disharmonie wahrzunehmen sind, so sollte auch die Zukunft des Urhebervertragsrechts, – Sinn, Rechtfertigung und Begrenzung des Schutzes geistiger Leistungen –, kontrovers und erkenntnisbringend debattiert werden. Rund 160 Zuhörer aus Wissenschaft und Politik, der Kreativwirtschaft, der Gerichtsbarkeit, der Rechtsanwaltschaft als auch Studierende waren der Einladung gefolgt. Die Tagung fand in Kooperation und mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Eigentum statt. Sie sollte der Frage nachgehen, ob in der Praxis die Beteiligung der Urheber und ausübenden Künstler an den durch die Werkverwertung erzielten Vergütungen angemessen ist oder ob der Gesetzgeber zur Erreichung dieses gesetzlichen Ziels (§ 11 UrhG) nachbessern muss.
Ist der Gesetzgeber gefordert?
Die Veranstaltung hatte auch zum Ziel, die existierenden gesetzlichen Regelungen zum Urhebervertragsrecht auf ihre Funktionstauglichkeit hin zu überprüfen. Dass Urhebern für ihr kreatives Schaffen eine Vergütung zusteht, stand dabei außer Frage. Ob und wie das vom Gesetzgeber angenommene strukturelle Ungleichgewicht zwischen Urhebern und Verwertern durch das bestehende Urhebervertragsrecht beseitigt wurde, sollte dagegen diskutiert werden.
Nach einem Grußwort durch den Intendanten des Deutschlandradios Dr. Willi Steul eröffnete Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer (Universität zu Köln) die Veranstaltung mit einem Überblick über die Urhebervertragsrechtsreform des Jahres 2002 und deren bisheriger Umsetzung in der Praxis. Anschließend erläuterte Prof. Dr. Joachim Bornkamm die Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum Urhebervertragsrecht. Prof. Dr. Haimo Schack, LL.M. (Universität zu Kiel) bot eine Zusammenfassung der durch die Reform ausgelösten Probleme sowie einen Ausblick auf mögliche künftige Reformschritte. Dr. Martin Diesbach (Rechtsanwälte Noerr LLP) erörterte schließlich die §§ 32, 32a UrhG aus der anwaltlichen Praxis. Die Referate wurden in einem sich daran anschließenden Diskussionspanel mit den Vortragenden und weiteren Diskutanten vertieft. Zu den Diskutanten gehörten die Rechtsanwälte Thomas von Petersdorff-Campen und Dr. Gernot Schulze, Peter Wiechmann (Justiziariat SWR) und Wolfgang Schimmel (Gewerkschaftssekretär ver.di e.V.).
In der Diskussion wurde deutlich, dass die Reform allseits als nicht sehr gelungen angesehen wurde, allerdings kontroverse Ansichten darüber bestanden, worin die Mängel und worin die Vorzüge liegen. Teilweise habe die Reform zwar zu einer Verbesserung der Position der Urheber geführt, teilweise bestünden Defizite, die die Regelungen nicht ausräumen konnten oder gar erst hervorgebracht haben.
Größte Schwierigkeit ist die Beurteilung der „Angemessenheit einer Vergütung“
Als Hauptschwierigkeit bei der Anwendung des Gesetzes erweist sich die unterbliebene Definition des Zentralbegriffs der Reform, nämlich der „Angemessenheit“ einer Vergütung. Zwar wurde als nachvollziehbar angesehen, dass die Definition eines „gerechten Preises“ ohnehin bereits Generationen von Juristen an die Grenzen ihrer Disziplin geführt hat und sich der Gesetzgeber daher bewusst im Zuge der Urheberrechtsreform 2002 gar nicht an einer Definition versuchte, sondern die Preisfindung den Parteien selbst in einem strukturierten tarifähnlichen Verfahren überlassen wollte. Doch wurde hierdurch das nächste Problem erzeugt: Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sollten in gleichberechtigten Verhandlungen Urheberverbände mit Verwertern an einen Tisch gebracht und die Angemessenheit der Vergütung durch eine kollektiv gestärkte Verhandlungsmacht bestimmt werden. Daneben sollten individuelle Verhandlungen zwar möglich bleiben. Der Gesetzgeber knüpfte an das System jedoch die Erwartung, dass die Anzahl der individuellen Verträge, die eine gerichtliche Angemessenheitsprüfung im Einzelfall zur Folge haben können, mit der Zeit in dem Maße obsolet würde, in dem neue Vergütungsregeln und Tarifverträge entstünden.
Gemeinsame Vergütungsregeln sind nach wie vor nicht die Regel
Umso überraschender war es, dass die individuelle Angemessenheitskontrolle durch die Gerichte jedenfalls kurzfristig doch zum wichtigsten Instrument wurde, weil sich herausstellte, dass gemeinsame Vergütungsregeln für sehr heterogene Branchen und Nutzungen nicht in kurzer Zeit gefunden werden konnten. Kollektive Regelungen blieben zunächst, nicht zuletzt wegen der außerordentlich langen Verhandlungsdauer, die Ausnahme. Der Zustand wurde allseits als unbefriedigend empfunden. Richter bemängeln, wie schwierig die Preisfindung ist, begrüßen aber, dass ihre im Einzelfall gefundenen Regeln jedenfalls wieder korrigierbar sind (so Bornkamm mit Blick auf die Vergütung für Nebenrechte in den Entscheidungen BGH/ 182, 337 - Talking to Addison und die Modifikation in BGH GRUR 2011, 328 - Destructive Emotions). Die Verwerter bedauern, dass die von Richtern gefundenen Regeln die Verhandlungen auch belasten können. Zudem erschwerten divergierende Entscheidungen der Zivilgerichte die Einigung in den kollektiven Verhandlungsrunden (Diesbach). In den bisherigen Prozessen im Filmbereich erhöhe ferner die Kombination aus Auskunfts- und ergänzenden Vergütungsansprüchen die Komplexität. Vielfach würden streitrelevante Fragen gar in das Ordnungsgeldverfahren verlagert (Diesbach). Aus Sicht der Wissenschaft kritisierte Schack, dass der Gesetzgeber die Problemlösung auf die Vergütung konzentriert hat. Sinnvoller sei es, die Dauer der Urheberverträge von vornherein zu begrenzen oder jedenfalls zwingende ordentliche Kündigungsrechte vorzusehen. Auch die Schwächung der Urheberposition durch Beseitigung des § 31 Abs. 4 UrhG hielt Schack für einen Fehler.
Die Verhandlungsmacht der Urheber wurde durch § 11 S. 2 UrhG gestärkt
Im Ergebnis blieb der Eindruck, dass die Verhandlungsmacht der Urheber durch § 11 S. 2 UrhG gestärkt und eine Entwicklung hin zu Gemeinsamen Vergütungsregeln und Tarifverträgen eingeleitet worden sei. Dennoch verlaufe dieser Prozess zu schleppend, weil die kollektive Einigung weder erzwungen noch durch richterliche Entscheidung ersetzt werden könne. Darüber hinaus gefährde die Preiskorrektur im Einzelfall die Rechtssicherheit. Die Reform des Urhebervertragsrechts ist daher unvollendet.
In der Diskussion wurden einige Lösungsvorschläge vertieft erörtert.
So forderte Braun (Fraktion DIE LINKE) die Anordnung einer Verbindlichkeit des Schlichterspruches oder eine gesetzlich verankerte Zwangsschlichtung, um Rechtssicherheit zu schaffen und die Vergütungsverhandlungen zu beschleunigen. Dies hielt Wiechmann für verfassungswidrig, weil man sich dadurch über die Autonomie der Beteiligten hinwegsetze. Von Petersdorff-Campen warf vermittelnd ein, dass auch nicht verbindlich gewordene Schlichtersprüche durchaus von den Gerichten berücksichtigt würden.
Gerichte greifen regulierend in den Markt ein
Die immer wieder monierte lange Verhandlungsdauer ist nach Meinung der Verwerterseite auch auf die Verschiedenheit und Komplexität der unterschiedlichen Kreativbranchen zurückzuführen, die derart heterogen ausgestaltet sein können, dass eine einzige Regelung mit allgemeiner Geltung eben nicht zu finden ist. Die Gerichte stehen also vor dem Dilemma, regulierend in den Markt eingreifen zu müssen, indem sie Preise für kreatives Schaffen teilweise ohne zugrundeliegende Anhaltspunkte festzusetzen haben.
Dass die gerichtliche Durchsetzung von Vergütungsansprüchen kein Allheilmittel ist, wurde mehrfach in der Diskussion betont.
Angst vor „Blacklisting“ verhindere die Rechtsdurchsetzung
Denn in einer Vielzahl von Fällen suchen Urheber ihre Rechtsdurchsetzung nicht vor Gericht. Aus Angst vor „Blacklisting“ und dem Verlust ihrer Existenzgrundlage bestünden oftmals Hemmungen, sich gegenüber dem Auftraggeber/Verwerter zu exponieren, so Schimmel.
Diesem Risiko müsste man mit einer Art Automatismus zugunsten der Urheber entgegenwirken, der eine angemessene Vergütung garantiert, ohne die Durchsetzung im Einzelfall gegenüber dem Vertragspartner zu erfordern, merkte Schulze an. Für ihn ist es mit dem Gesetzeszweck auch nicht vereinbar, dass die lange Schutzdauer des Urheberrechts allein dem Verwerter zugutekommt. Schack empfahl bereits in seinem Vortrag ein gesetzliches ordentliches Kündigungsrecht nach Ablauf von 30 Jahren für den Urheber, welches branchenspezifisch noch modifiziert werden könnte. Schulze bevorzugte eine zeitliche Befristung der Nutzungsrechtseinräumung durch Gesetz, weil so dem Urheber die Last, selbst tätig werden zu müssen, erspart würde.
Verbandsklage, ordentliches Kündigungsrecht oder zeitliche Befristung der Rechtseinräumung könnten Abhilfe schaffen
Um das Risiko des „Blacklisting“ zu minimieren, wurde die Möglichkeit einer Verbandsklage im Diskussionspanel erwogen. Da das Urhebervertragsrecht an seiner mangelnden Durchsetzung leide, könnte das Ziel einer etwaigen Reform die verbesserte Möglichkeit einer Verbandsklage sein, so Schimmel.
Schack plädierte schließlich dafür, der unzureichenden Inhaltskontrolle von überschießenden Lizenzvertragsklauseln durch eine zwingende Ausgestaltung des § 31 Abs. 5 UrhG zu begegnen. Bislang bestünde kaum eine Handhabe gegen unangemessene Nutzungsverträge, die weder gegen § 138 BGB verstoßen, noch § 31 Abs. 5 UrhG verletzen. Der Gesetzgeber habe dies zwar erkannt und aus diesem Grunde den Beteiligungsgrundsatz in § 11 S. 2 UrhG kodifiziert, doch habe dies nicht zu einer wirkungsvollen Inhaltskontrolle geführt. Nach wie vor billigt der BGH § 31 Abs. 5 UrhG keine Leitbildfunktion im Hinblick auf die Durchsetzung einer angemessenen Vergütung zu. Durch eine zwingende Ausgestaltung der Norm wären Lizenznehmer verpflichtet, die beabsichtigte Nutzung offen zu legen, was einen Rechtekauf auf Vorrat möglicherweise verhindere, jedenfalls aber den Gerichten die Überprüfung von Lizenzverträgen erleichtere.
§ 32a UrhG ist größtenteils gelungen
Als überwiegend gelungen beurteilten die Diskutanten § 32a UrhG, den sogenannten „Bestsellerparagraphen“. Dieser gebe den Urhebern ein schlagkräftiges Nachforderungsrecht an die Hand, so Schack. Diesbach monierte jedoch, dass die Frage der Angemessenheit auch in § 32a UrhG eine Rolle spiele und der Mangel des § 32 UrhG auch die Handhabung des § 32a UrhG erschwere. Als noch ungelöst wurde die Frage bezeichnet, welche weitere Beteiligung angemessen im Sinne des § 32a UrhG in Fällen ist, in denen ein Werk von mehreren Urhebern geschaffen wurde. Denn bisher sei nicht geklärt, in welchem Verhältnis unterschiedliche Beiträge an einem Werk zu gewichten sind (vgl. die Entscheidungen des OLG München GRUR-RR 2011, 245 - „Tatort-Vorspann“; BGH GRUR 2012, 1248 - „Fluch der Karibik“; BGH GRUR 2012, 496 - „Das Boot“).
Das Ergebnis der Tagung brachte der Schauspieler Heinrich Schafmeister auf den Punkt, indem er meinte, eine Reform könne nicht als missglückt bezeichnet werden, wenn sie dazu führe, dass bessere Lösungen gesucht würden.
Die Vorträge und Diskussionsbeiträge sind in einem Tagungsband der Schriftenreihe des Instituts für Rundfunkrecht veröffentlicht.
Der Bericht ist in der August-Ausgabe der proMedia erschienen (ausgewählte Artikel, Interviews und weitere medienpolitische Informationen finden Sie unter medienpolitik.net). Aktuelle wöchentliche Schlagzeilen aus den Bereichen des Rundfunk- und Medienrechts stellen wir für Sie auf unserer Homepage, bei Facebook und Twitter bereit.
von Camilla Kling, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln