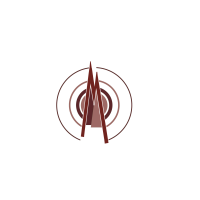Datenschutzrecht - Bundesrat: Gesetzesentwurf zur Änderung des TMG beschlossen
Rundfunkrecht - BDZV: Zeitungsverlage klagen gegen Tagesschau-App
Fernsehrichtlinie - EuGH: Schleichwerbung auch ohne Entgelt möglich
Presserecht - BGH: Kein Falschzitat der Äußerungen Eva Hermanns
Kartellrecht - BKartA: Keine grundsätzlichen Bedenken gegen DFL-Vermarktungspläne
Rundfunkrecht - OVG Rheinland-Pfalz: Eilantrag gegen Verfahren der ZDF-Intendantenwahl abgewiesen
Persönlichkeitsrecht - BGH: Öffentliches Informationsinteresse rechtfertigt unverpixelte Bildveröffentlichung trotz sitzungspolizeilcher Anordnung
IT-Recht - Cyber-Abwehrzentrum offiziell eröffnet / BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland / Einrichtung einer EU-Sondereinheit zur Bekämpfung von Internet-Kriminalität beschlossen
Rundfunkrecht - Landesmedienanstalten legen Studie zu ein Jahr Produktplatzierung vor
Presserecht - Presserat: Öffentliche Rüge wegen Persönlichkeitsverletzung
Presserecht - LG Hamburg: Suggestive Berichterstattung über unlautere Recherchemethoden unzulässig
Jugendmedienschutz - Jugendschutz.net: Jahresbericht 2010 zu Jugendschutz im Internet veröffentlicht
Urheberrecht - BGH: Urheberrechtsschutz von Lernspielen als Darstellungen wissenschaftlicher ArtVerbraucherschutzrecht - Bundesrat: Gesetzesinitiative zur Bekämpfung unerwünschter Telefonwerbung
Glücksspielrecht - BVerwG: Verbot von Sportwetten im Internet gemäß GlüStV rechtmäßig
Datenschutzrecht
Bundesrat: Gesetzesentwurf zur Änderung des TMG beschlossen
- In seiner Sitzung am 17. Juni 2011 hat der Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes (TMG) beschlossen, mit dem der Datenschutz in Online-Diensten, insbesondere in sozialen Netzwerken, verbessert werden soll. Problematisch seien derzeit vor allem die für Nutzer mangelnde Transparenz bei der Verwendung persönlicher Daten durch die Diensteanbieter sowie die fehlende Aufklärung über die mit einer Datenpreisgabe verbundenen Risiken. Insbesondere Kindern und Jugendlichen sei oft nicht klar, dass alle Daten und Fotos „wie an einem schwarzen Brett“ für andere Nutzer sichtbar seien. Mit dem Gesetzesentwurf sollen nun die Informationspflichten der Anbieter gegenüber den Nutzern verstärkt werden. Unter anderem hätten Anbieter von sozialen Netzwerken, die verschärften Vorschriften unterliegen sollen, künftig standardmäßig die höchstmögliche Sicherheitsstufe voreinzustellen. Auch soll es der Nutzer jederzeit selbst veranlassen können, dass die veröffentlichten Daten wieder gelöscht oder zumindest gesperrt werden. Der Gesetzesvorschlag wird nun dem Bundestag zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet.
- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes (TMG), BR-Drs. 156/11
- Meldung bei heise.de vom 17.06.2011
- Pressemitteilung des Hessischen Innenministeriums vom 17.06.2011
Rundfunkrecht
BDZV: Zeitungsverlage klagen gegen Tagesschau-App
- Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger e. V. haben am 21. Juni 2011 acht Zeitungsverlage bei der Wettbewerbskammer des Kölner Landgerichts Klage gegen ARD und NDR eingereicht. Ihrer Ansicht nach verstoße die vom Rundfunkrat des NDR im Rahmen des Drei-Stufen-Tests genehmigte sog. „Tagesschau-App“ gegen den Rundfunkstaatsvertrag (RStV), wonach gemäß § 11d nicht sendungsbezogene presseähnliche Telemedien-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht zulässig sind. Die Praxis habe jedoch gezeigt, dass sich die Rundfunkhäuser nicht an die rechtlichen Vorgaben hielten, so der BDZV. NDR-Intendant Lutz Marmor bedauerte den Schritt der Verleger, da sich die App in der Kernkompetenz der Information befinde.
- Pressemitteilung des BDZV vom 21.06.2011
- Pressemitteilung des NDR vom 21.05.2011
- Meldung in epd medien aktuell Nr. 118a vom 21.06.2011
- Meldung auf spiegel.de vom 21.06.2011
- Meldung auf handelsblatt.com vom 22.06.2011
- Meldung auf tagesschau.de vom 21.06.2011
- Rundfunkstaatsvertrag i. d. F. des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 10.03.2010, in Kraft getreten am 01.04.2010, zum Download auf die-medienanstalten.de (PDF)
Fernsehrichtlinie
EuGH: Schleichwerbung auch ohne Entgelt möglich
- Mit Urteil vom 9. Juni 2011 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass „Schleichwerbung“ i.S.d. Art. 1 lit. d der Richtlinie 89/552/EWG in der durch die Richtlinie 97/36/EG geänderten Fassung auch bei Fehlen eines Entgelts vorliegen kann. Zwar stelle die Existenz eines Entgelts oder einer ähnlichen Gegenleistung ein Kriterium dar, anhand dessen sich die Werbeabsicht feststellen lasse. Aus der Definition in der Richtlinie sowie deren Systematik und Zweck ergebe sich jedoch, dass diese Absicht bei Fehlen eines solchen Entgelts nicht ausgeschlossen werden könne. Da die Feststellung, ob ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung im Zusammenhang mit einer Fernsehwerbung vorliege, ohnehin meist sehr schwierig sei, dürfe im Interesse des zu schützenden Fernsehzuschauers eine solche nicht als notwendige Voraussetzung von „Schleichwerbung“ angesehen werden.
- Pressemitteilung Nr. 57/11 des EuGH vom 09.06.2011
- Urteil des Gerichtshofs vom 09.06.2011 – Rs. C-52/10
- RL 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (alte Fassung)
- Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG
- Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG
Presserecht
BGH: Kein Falschzitat der Äußerungen Eva Hermanns
- Mit Urteil vom 21. Juni 2011 hat der Bundesgerichtshof (BGH) entgegen den Vorinstanzen entschieden, dass die Berichterstattung des „Hamburger Abendblatts“ über eine Pressekonferenz, auf der die Journalistin Eva Hermann ein von ihr verfasstes Buch vorgestellt hatte, ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht nicht beeinträchtigt. Hermann hatte sich in dem betreffenden Artikel falsch zitiert gesehen. Der BGH entschied nun, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht zwar den Einzelnen davor schütze, dass ihm Äußerungen zugeschrieben werden, die er nicht getan hat und die seine Privatsphäre oder seinen sozialen Geltungsanspruch beeinträchtigten. Davon umfasst sei neben Fehlzitaten auch die unrichtige, verfälschte und entstellte Wiedergabe einer Äußerung. Vorliegend lasse die von der Klägerin getätigte Äußerung im Gesamtzusammenhang betrachtet gemessen an Wortwahl, Kontext der Gedankenführung und Stoßrichtung jedoch nur die Deutung zu, die die beklagte Zeitung ihr beigemessen hatte.
- Pressemitteilung Nr. 107/2011 des BGH vom 21.06.2011
- Meldung auf beck-aktuell.beck.de vom 21.06.2011
- Meldung auf zeit.de vom 21.06.2011
Vorinstanzen:
- OLG Köln, Urteil vom 28.07.2009 – Az. 15 U 37/09, veröffentlicht in AfP 2009, 603
- LG Köln, Urteil vom 14.01.2009 – Az. 28 O 511/08
Kartellrecht
BKartA: Keine grundsätzlichen Bedenken gegen DFL-Vermarktungspläne
- Das Bundeskartellamt (BKartA) hat am 20. Juni seine Zustimmung zu den Vermarktungsplänen der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) ab der Spielzeit 2013/2014 signalisiert. Während Einzelheiten noch der Klärung bedürften, stünden den Plänen keine grundsätzlichen kartellrechtlichen Bedenken entgegen. Das von der DFL derzeit geplante Vermarktungsmodell enthält demnach im Hinblick auf die Highlight-Berichterstattung im Free-TV zwei alternative Szenarien: Szenario I sehe eine Highlight-Berichterstattung ab 18.30 Uhr im Free-TV vor, Szenario II hingegen eine Highlight-Berichterstattung über „Netcast“ (im Wesentlichen Web-TV) ab 19.00 Uhr sowie eine Berichterstattung im Free-TV ab 21.45 Uhr. Im Jahre 2008 hatte das BKartA noch zu erkennen gegeben, dass eine „zeitnahe“ Free-TV-Highlight-Berichterstattung für eine Genehmigung wesentlich sei. Aktuelle Marktermittlungen hätten aber ergeben, dass eine vergleichbare Vorgabe für die jetzt zu prüfenden Pläne der DFL nicht gerechtfertigt wäre.
- Pressemitteilung des BKartA vom 20.06.2011
- Pressemitteilung der DFL vom 20.06.2011
- Meldung auf kress.de vom 20.06.2011
Rundfunkrecht
OVG Rheinland-Pfalz: Eilantrag gegen Verfahren der ZDF-Intendantenwahl abgewiesen
- Mit Beschluss vom 16. Juni 2011 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz einen Eilantrag gegen die Intendantenwahl beim ZDF abgelehnt. Ein Bewerber um die Stelle des Intendanten dürfe vom weiteren Auswahlverfahren ausgeschlossen werden, wenn kein einziges der 77 Fernsehratsmitglieder seine Bewerbung unterstützt und ihn zur Wahl vorschlägt. Der Antragsteller hatte sich um die Stelle des Intendanten des ZDF beworben, der für eine erfolgreiche Wahl gemäß § 26 des ZDF-Staatsvertrages drei Fünftel der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder des Fernsehrates benötigt. Seine Bewerbungsunterlagen seien zuvor sämtlichen Fernsehratsmitgliedern bekannt gemacht; keines der Mitglieder habe jedoch die Bewerbung als Wahlvorschlag eingebracht. Nach den vom Fernsehrat selbst beschlossenen Verfahrensgrundsätzen werde eine Eigenwerbung nur dann zugelassen, wenn sie von mindestens einem Fernsehratsmitglied unterstützt wird.
Der Antragssteller hatte sich mit seinem Eilantrag zunächst an das Verwaltungsgericht (VG) Mainz gegen das Wahlverfahren gewandt und dessen Abbruch gefordert. Seiner Ansicht nach werde er durch das Erfordernis der Unterstützung eines Fernsehratmitglieds benachteiligt. Außerdem verletze es seine Rechte, dass er anders als ein Mitbewerber nicht vom Fernsehrat zu einer persönlichen Vorstellung eingeladen worden sei. Schließlich sei bereits die Zusammensetzung des Fernsehrates wegen Verstoßes gegen das parteipolitische Beherrschungsverbot verfassungswidrig. Das Verwaltungsgericht Mainz hatte den Antrag mit Beschluss vom 6. Juni 2011 abgelehnt (Az. 4 L 566/11.MZ), da das Wahlverfahren angesichts des für die Wahl zum Intendanten erforderliche Quroum von drei Fünftel der Stimmen gerechtfertigt sei. Vor dem OVG berief sich der Antragsteller auch auf die Europäische Grundrechtecharta, insbesondere die Medienfreiheit, das Pluralismusgebot und den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das OVG wies die Einwendungen jedoch als unbegründet zurück.
Zum neuen Intendanten des ZDF wurde indes am 17. Juni 2011 der bisherige Programmdirektor Thomas Bellut gewählt. Von den 73 anwesenden Fernsehratsmitgliedern stimmten bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen 70 Mitglieder für Bellut, der am 15. März 2012 die Nachfolge des amtierenden Intendanten Markus Schächter antreten wird.
- Pressemitteilung des OVG Rheinland-Pfalz vom 17.06.2011
- Pressemitteilung des VG Mainz vom 15.06.2011
- ZDF-Staatsvertrag zum Download auf zdf.de (PDF)
- Meldung des ZDF vom 17.06.2011 auf zdf.de
- Geschäftsordnung des ZDF-Fernsehrates auf zdf.de (PDF)
Persönlichkeitsrecht
BGH: Öffentliches Informationsinteresse rechtfertigt unverpixelte Bildveröffentlichung trotz sitzungspolizeilcher Anordnung
- Mit Urteil vom 7. Juni 2011 (Az. VI ZR 108/10) hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass die Veröffentlichung eines Bildes, das während eine Urteilsverkündung aufgenommen wurde und den wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit versuchter Beteiligung an einem Mord Veurteilten mit – unverpixeltem – Gesicht zeigt, zulässig ist.
Das Strafverfahren, in dem das gegenständliche Bild entstand, hatte den geplanten Anschlag einer sog. „Terrorgruppe“ zum Gegenstand. Während der Hauptverhandlung waren Fotoaufnahmen durch sitzungspolizeiliche Verfügungen der Vorsitzenden Richterin nach § 176 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) insofern eingeschränkt, als dass auf Fotos der Angeklagten ihre Gesichter etwa durch Verpixelung unkenntlich zu machen waren. Im Rahmen der Berichterstattung über die Urteilsverkündung veröffentlichte die Beklagte im Juli 2008 unter der Überschrift „Irak-Terroristen müssen für Attentatsplan ins Gefängnis!“ ein Foto des Klägers, auf dem sein Gesicht deutlich zu erkennen war. Der Abgebildete nahm daraufhin die Beklagte auch Unterlassung Anspruch.
Anders als die Vorinstanzen entschied der BGH nun, dass dem Kläger kein Anspruch auf Unterlassung der identifizierenden Bildberichterstattung zusteht. Die Zulässigkeit einer Bildveröffentlichung sei grundsätzlich nach dem abgestuften Schutzkonzept der §§ 22, 23 Kunsturhebergesetz (KUG) zu beurteilen. Vorliegend handele sich bei der Berichterstattung über die Urteilsverkündung um ein zeitgeschichtliches Ereignis im Sinne des § 23 Abs. 1 KUG, an dem ein erhebliches Informationsinteresse der Öffentlichkeit bestanden habe. Demgegenüber müsste der Persönlichkeitsschutz des Klägers zurücktreten. Entgegen dem Berufungsgericht maß der BGH dem Umstand, dass der Kläger nach eigener Aussage nur im Vertrauen auf die sitzungspolizeiliche Anordnung die Fotoaufnahmen zuließ, ohne sich dabei etwa das Gesicht zu schützen, kein entscheidendes Gewicht zu. Zu berücksichtigen sei, dass gemäß §§ 22, 23 KUG unverpixelte Bildaufnahmen auch ohne Einwilligung des Klägers zulässig gewesen wären. Durch sein Verhalten hätte er nach Auffassung des BGH letztlich allenfalls Bildaufnahmen vereiteln können, die wegen des Informationsinteresses der Öffentlichkeit – trotz der Anordnung der Vorsitzenden Richterin – ohnehin grundsätzlich zulässig waren. Das Persönlichkeitsrecht sei auch im Rahmen der Sitzungspolizei nicht in weiterem Umfang zu schützen als dies nach §§ 22, 23 KUG der Fall ist.
- Pressemitteilung Nr. 99/2011 des BGH vom 07.06.2011
Vorinstanzen:
- LG Berlin, Urteil vom 26.02.2009 – Az. 27 O 982/08 via eisenberg-koenig.de
- KG Berlin, Urteil vom 06.04.2010 – Az. 9 U 45/09
IT-Recht
Cyber-Abwehrzentrum offiziell eröffnet / BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland / Einrichtung einer EU-Sondereinheit zur Bekämpfung von Internet-Kriminalität beschlossen
- Gemeinsam mit den Präsidenten der beteiligten Behörden hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich am 16. Juni 2011 offiziell das Nationale Cyber-Abwehrzentrum (NCAZ) eröffnet, dessen Einrichtung Teil der von der Bundesregierung am 23. Februar 2011 beschlossenen sog. Cyber-Sicherheitsstrategie ist. Das Zentrum hatte bereits am 1. April 2011 seine Arbeit aufgenommen und soll nach Angaben des Bundesinnenministeriums als gemeinsame Plattform zum schnellen Informationsaustausch und zur besseren Koordinierung von Schutz- und Abwehrmaßnahem gegen IT-Sicherheitsvorfälle dienen. Die Errichtung erfolgte unter der Federführung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und unter direkter Beteiligung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Die insgesamt zehn festen Mitarbeiter des Zentrums werden von diesen drei Behörden gestellt. Zudem wirken nunmehr auch das Bundeskriminalamt (BKA), die Bundespolizei (BPol), das Zollkriminalamt (ZKA), der Bundesnachrichtendienst (BND) sowie die Bundeswehr als assoziierte Behörden mit.
Aufgabe des NCAZ soll sein, IT-Sicherheitsvorfälle schnell und umfassend zu bewerten und abgestimmte Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Dazu sollen u.a. Informationen über Schwachstellen in IT-Produkten ausgetauscht sowie IT-Vorfälle, Verwundbarkeiten und Angriffsformen analysiert werden. Alle beteiligten Behörden arbeiteten dabei unter Beibehaltung ihrer bisherigen gesetzlichen Befugnisse.
Anlässlich der Eröffnung hat das BSI am 16. Juni 2011 den Bericht „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2011“ vorgestellt. Demzufolge werde nach wie vor eine hohe Anzahl von IT-gestützten Angriffen beobachtet; hinzu käme dabei eine neue Qualität zielgerichteter Attacken.
Auch auf europäischer Ebene soll der Kampf gegen Cyber-Kriminalität forciert werden. So beschlossen Vertreter der Innen- und Justizministerien der Mitgliedstaaten am 10. Juni 2011, den Rahmenbeschluss über Angriffe auf Informationssysteme aus dem Jahr 2005 zu erweitern und eine Sondereinheit zur Bekämpfung der Internetkriminalität einzurichten. Dabei sollen u.a. die Strafen für Hacker erhöht und das illegale Abfangen von Daten EU-weit als Straftat verfolgt werden.
- Pressemitteilung vom 16.06.2011
- Nationales Cyber-Abwehrzentrum nimmt Arbeit auf, Pressemitteilung des BSI vom 01.04.2011
- Bundesregierung beschließt Sicherheitsstrategie für den Cyber-Raum, Pressemitteilung des BMI vom 23.02.2011
- Präsentation: Cyber-Sicherheit in Deutschland auf bmi.bund.de
- BSI stellt Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2011 vor, Pressemitteilung vom 16.06.2011
- BSI-Lagebericht IT-Sicherheit 2011 auf bsi.bund.de
- Meldung vom 10.06.2011 auf tageschau.de
- Meldung vom 14.06.2011 auf heise.de
- Rahmenbeschluss 2005/222/JI des Rates vom 24.02.2005 über Angriffe auf Informationssysteme
Rundfunkrecht
Landesmedienanstalten legen Studie zu ein Jahr Produktplatzierung vor
- Nachdem seit Inkrafttreten des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) in der Fassung des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrages (RÄStV) zum 1. April 2010 und damit der Neuregelungen hinsichtlich – nunmehr unter bestimmten Bedingungen zulässiger – Produktplatzierung mittlerweile ein gutes Jahr vergangen ist, haben die Landesmedienanstalten am 14. Juni 2011 ein von ihnen in Auftrag gegebenes Gutachten über die Entwicklung jener Produktplatzierungen veröffentlicht. Die durch das Institut für Medienforschung IM?GÖ durchgeführte Studie liefere demnach erstmals empirische Erkenntnisse über den Einsatz von Produktplatzierung. Untersucht wurden nach eigenen Angaben mehr als 5000 Programmstunden aus Herbst 2010 und Frühjahr 2011 in sieben privaten Vollprogrammen, zehn privaten Spartenprogrammen und drei öffentlich-rechtlichen Vollprogrammen.
Zusammenfassend stellt das Gutachten fest, dass eine flächendeckende Durchdringung des deutschen Fernsehprogramms mit Produktplatzierungen derzeit noch nicht gegeben sei. Die Gründe hierfür seien vor allem in der noch nicht geklärten Aufteilung der Erlöse zwischen Produzenten und Veranstaltern zu sehen. Insgesamt ließe sich konstatieren, dass die privaten Fernsehveranstalter im Beobachtungszeitraum überwiegend die rechtlichen Bestimmungen eingehalten haben. Problematisch sei, dass mit der im 13. RÄStV vorgenommenen Definition der Produktplatzierung ein Großteil der im Fernsehen sichtbaren Produkte, Marken und Firmen nicht erfasst sei. Dabei handele es sich zum einen um unvermeidbares und unbezahltes Placement sowie zum anderen um vermeidbare und unbezahlte Platzierung von Produkten. In der Programmpraxis könne der Zuschauer nicht immer erkennen, ob es sich bei den Produkten um ungekennzeichnete Produktplatzierungen, unentgeltliche Beistellungen oder lediglich um zufällige unbeabsichtigte Einblendungen handele. Das zentrale Ziel des Gesetzgebers, den Zuschauer über den Status der im redaktionellen Programm erscheinenden Markenprodukte aufzuklären und diesbezüglich Transparenz zu schaffen, werde demnach nicht immer erreicht.
- ZAK-Pressemitteilung 12/2011 vom 14.06.2011
- Studie „Die Regelungen zur Produktplatzierung im Rundfunkstaatsvertrag und in den Gemeinsamen Werberichtlinien der Landesmedienanstalten und ihre Umsetzung im TV“ (Mai 2011) zum Download auf die-medienanstalten.de (PDF)
Presserecht
Presserat: Öffentliche Rüge wegen Persönlichkeitsverletzung
- Die Beschwerdeausschüsse des Deutschen Presserats haben in ihren vergangenen Sitzungen 90 Beschwerden behandelt, wonach neben 27 Hinweisen und 14 Missbilligungen acht Rügen – drei nicht-öffentlich und fünf öffentlich – ausgesprochen worden. Dies teilte der Presserat am 10. Juni 2011 mit.
Die nicht-öffentlichen Rügen erfolgten danach wegen Berichterstattungen über mutmaßliche Täter von Straftaten, die ungepixelte Fotos dieser enthielten. In allen drei Fällen habe dabei kein überwiegendes öffentliches Interesse an der identifizierenden Berichterstattung vorgelegen. Die öffentlichen Rügen seien in drei Fällen wegen Verletzung des in Ziffer 7 des Pressekodex statuierten Grundsatzes der klaren Trennung von Redaktion und Werbung erteilt worden. Eine weitere öffentliche Rüge erfolgte wegen der Abbildung eines Fotos, das einen namentlich genannten „Facharzt“ zeigte; tatsächlich handelte es sich dabei jedoch um ein Fotomodell. Die damit wahrheitswidrige Berichterstattung stellte einen Verstoß gegen Ziffer 1 des Pressekodex‘ dar. Die fünfte öffentliche Rüge erging schließlich für einen Bericht über den Fußball-Profi Michael Ballack. In einem mit dem Titel „Ehe-Drama“ überschriebenen Artikel wurde darüber spekuliert, ob er ein „geheimes Doppel-Leben“ mit einer anderen Frau führe. Abgedruckt wurde dabei ein Foto, welches bei einem Auftritt Ballacks für eine Hilfsorganisation entstanden war und eine Repräsentantin der Organisation zeigte, die als „unbekannte Begleiterin“ bezeichnet wurde. Nach Ansicht des Beschwerdeausschusses konnte die Redaktion die aufgestellten Behauptungen nicht belegen. Die somit nicht durch hinreichende Tatsachen gestützte, moralisch abwertende Berichterstattung sei dazu geeignet, die Persönlichkeitsrechte und die Ehre von Ballack, seiner Frau sowie der betroffenen Mitarbeiterin der Hilfsorganisation zu verletzen.
Die öffentliche Rüge stellt das härteste Sanktionsmittel des Deutschen Presserats dar. Sie ist gemäß Ziffer 16 des Pressekodex in dem gerügten Medium zu veröffentlichen.
- Pressemitteilung des Deutschen Presserats vom 10.06.2011
- Publizistische Grundsätze (Pressekodex) auf presserat.de (PDF)
Presserecht
LG Hamburg: Suggestive Berichterstattung über unlautere Recherchemethoden unzulässig
- Mit Urteil vom 30. Mai 2011 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass eine Presseberichterstattung unzulässig ist, die den Eindruck erweckt, eine andere Illustrierte habe von angeblich unlauteren Recherchemethoden eines Auftragnehmers gewusst (Az. 324 O 246/10). Gegenstand des Rechtsstreits war ein in einer von der Beklagten verlegten Zeitschrift veröffentlichter Artikel, der die „verbotenen Recherchemethoden“ einer Bildagentur zum Inhalt hatte. In einer Überschrift des Artikels hieß es, „das Privatleben von Berliner Spitzenpolitikern wurde monatelang systematisch ausgeforscht. Prominente Opfer waren [...]. Die Aufträge kamen von der Illustrierten [...]. Insider packen aus.“ Die Parteien stritten nun vor Gericht darüber, ob die Klägerin, die die betroffene Illustrierte verlegt, über die Recherchemethoden informiert war. Nach Ansicht der Klägerin wurde durch die Berichterstattung der Beklagten der unzutreffende Eindruck erweckt, sie habe die Agentur in dem Wissen eingeschaltet, dass die betroffenen Politiker mit „geheimdienstlichen“ oder gar kriminellen Methoden überwacht oder ausspioniert würden oder werden sollten. Nach Ansicht der Beklagten enthielt der Artikel hingegen keine Suggestion in diesem Sinne, sondern lediglich die Mitteilung über das Auftragsverhältnis zwischen Agentur und Klägerin.
Das Landgericht gab nun der Unterlassungsklage statt und entschied, dass die Klägerin durch die konkrete Berichterstattung in ihrem allgemeinen Unternehmerpersönlichkeitsrecht verletzt werde. Ein durchschnittlicher Leser habe die angegriffenen Textpassagen zwingend so verstehen müssen dass die Klägerin von den beschriebenen Recherchemethoden gewusst habe. Da der Beklagten nicht der Gegenbeweis gelungen sei, handele es sich dabei um eine unwahre Tatsachenbehauptung, die geeignet sei, die Klägerin herabzuwürdigen.
- Pressemitteilung des LG Hamburg vom 30.05.2011
- Meldung auf beck-aktuell.de vom 31.05.2011
Jugendmedienschutz
Jugendschutz.net: Jahresbericht 2010 zu Jugendschutz im Internet veröffentlicht
- Die gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder „jugendschutz.net“ hat am 31. Mai 2011 ihren Jahresbericht 2010 veröffentlicht. Schwerpunkte der vorangegangenen Recherche waren der sexuelle Missbrauch von Kindern, die Propagierung von Selbstgefährdungen sowie rechtsextreme Beiträge in „Web-2.0“-Diensten. Demnach waren im vergangenen Jahr insgesamt mehr Verstöße im Web 2.0 zu verzeichnen als im Jahr zuvor. Kinder und Jugendliche seien zunehmenden Risiken durch unzulässige Inhalte ausgesetzt, die häufiger aus dem Ausland stammten, um sich nationalen Regulierungen weitgehend zu entziehen. Notwendig seien daher weltweite Standards, Codes of Conduct und Schutzregelungen. „Mobbingplattformen“, Belästigungen in Zufallschats und Hasskommentare in sozialen Netzwerken zeigten, dass sich das Internet nicht immer von selbst reguliere. Insgesamt kontrollierte jugendschutz.net in 2010 nach eigenen Abgaben 11.800 Websites und 1.250 Fundstellen in Suchmaschinen, 1.360 Kommentare auf Web-2.0-Plattformen, 8.000 Videoclips, Downloads und Bilder sowie 16.500 Profile. Insgesamt seien 7.600 Hinweise aus der Bevölkerung auf Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen eingegangen.
Seit Gründung im Jahre 1997 unterstützt die gemäß § 18 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) eingerichtete Stelle jugendschutz.net die obersten Landesjugendbehörden (Jugendministerien der Länder) bei der Durchsetzung des Jugendschutzes im Internet. Mit dem JMStV wurde die Internet-Aufsicht 2003 der Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten übertragen und jugendschutz.net organisatorisch an die KJM angebunden.
- Pressmitteilung von jugendschutz.net vom 31.05.2011
- Jahresbericht 2010 zum Download auf jugendschutz.net (PDF)
- Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM)
- Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) zum Download auf den Seiten der KJM (PDF)
Urheberrecht
BGH: Urheberrechtsschutz von Lernspielen als Darstellungen wissenschaftlicher Art
- Mit Urteil vom 1. Juni 2011 hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden, dass Lernspiele nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG als Darstellungen wissenschaftlicher Art urheberrechtlich geschützt sein können (Az. I ZR 140/09). Für solche Darstellungen sei es begriffswesentlich, dass sie der Vermittlung von belehrenden oder unterrichtenden Informationen dienten. Gegenstand der zugrunde liegenden Klage waren Lernspiele, die jeweils aus einem Kontrollgerät sowie Aufgaben- oder Übungsheften bestanden. Die Klägerin hatte die Beklagte auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Verletzung ihrer Urheberrechte in Anspruch genommen, nachdem diese Lernspiele weitgehend nach demselben didaktischen Prinzip hergestellt und vertrieben hatte.
Der BGH entschied nun, dass die Kontrollgeräte im Zusammenspiel mit den Übungsheften solche Informationen vermittelten. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hatte zuvor noch anders geurteilt: Nach dessen Auffassung enthielten die Geräte keine Darstellung wissenschaftlicher Art; der Umstand, dass mit ihrer Hilfe das Ergebnis einer Übungsaufgabe als richtig oder falsch verifiziert werden kann, genüge nicht. Nach Ansicht des BGH hingegen kann bereits der Darstellung einfachster wissenschaftlicher Erkenntnisse ein Urheberrechtsschutz zukommen. Mit der – vom OLG angeführten – Begründung, dass sich Inhalte und Aufgaben der Übungshefte der Beklagten von denen der Klägerin unterscheiden, könne eine Urheberrechtsverletzung nicht verneint werden. Maßgeblich sei nicht, was, sondern wie etwas hergestellt werde. Nur die Form der Darstellung könne deren Urheberrechtsschutz begründen.
- Pressemitteilung Nr. 93/2011 des BGH vom 01.06.2011
Vorinstanzen:
- LG Köln, Urteil vom 03.12.2008 – Az. 38 O 483/06
- OLG Köln, Urteil vom 28.08.2009 – Az. 6 U 225/08, veröffentlicht in GRUR-RR 2010, 147 = ZUM 2010, 176, Volltext auf telemedicus.info
Verbraucherschutzrecht
Bundesrat: Gesetzesinitiative zur Bekämpfung unerwünschter Telefonwerbung
- Der Bundesrat hat am 27. Mai 2011 den Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes im Bereich unerlaubter Telefonwerbung beim Bundestag eingebracht. Erklärtes Ziel ist es, unerlaubte Telefonwerbung künftig nicht nur mit Hilfe des Wettbewerbsrechts, sondern auch mit vertragsrechtlichen Instrumenten zu bekämpfen. Unseriöse Unternehmen sollen daran gehindert werden, im Rahmen eines Werbeanrufs dem Verbraucher Verträge „unterzuschieben“. Ein telefonisch vereinbarter Vertrag soll demnach künftig erst dann wirksam werden, wenn der Verbraucher ihn innerhalb von 14 Tagen schriftlich bestätigt. Zudem soll die Verwendung automatischer Anrufmaschinen durch entsprechende Ordnungsstrafen unterbunden werden. Zur Verstärkung der Abschreckungswirkung soll außerdem der Bußgeldrahmen insgesamt erhöht werden.
Konkret sieht der Entwurf u. a. die Einführung eines § 312b1 („Vertragsschluss bei Telefonwerbung“) in das BGB vor. Begründet wird die Initiative damit, dass sich die mit dem Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen vom 29. Juli 2009 eingeführten Neuregelungen als nicht hinreichend effektiv erwiesen hätten. So seien etwa bei den Verbraucherzentralen nach eigenen Angaben zwischen März und November 2010 fast 80.000 Beschwerden wegen unerwünschter Werbeanrufe eingegangen; ebenso viele Eingaben registrierte die Bundesnetzagentur in den ersten zwölf Monaten nach Inkrafttreten der Gesetzesänderungen.
- Pressemitteilung Nr. 78/2011 des Bundesrats vom 27.05.2011
- Zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Verbraucherschutzes im Bereich unerlaubter Telefonwerbung (Drs. 271/11)
- Meldung vom 30.05.2011 auf beck-online.de
Glücksspielrecht
BVerwG: Verbot von Sportwetten im Internet gemäß GlüStV rechtmäßig
- Mit Urteil vom 1. Juni 2011 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass das im Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) normierte Verbot, Sportwetten und andere öffentliche Glücksspiele im Internet zu veranstalten, zu vermitteln oder hierfür zu werben, sowohl mit dem Grundgesetz als auch dem europäischen Unionsrecht vereinbar ist. Das Gericht wies damit eine Klage ab, die sich gegen die Untersagung des Vertriebs von Sportwetten im Internet gerichtet hatte, nachdem zuvor eine Erlaubnis zum Betrieb eines Wettbüros bestanden hatte.
Das Internet-Verbot diene dem verfassungs- und unionsrechtlich legitimen Zweck, den mit der zeitlich und örtlich grundsätzlich unbeschränkten Verfügbarkeit der Glücksspiel-Angebote im Internet verbundenen besonderen Gefahren entgegenzuwirken. Geschützt werden sollten vor allem Jugendliche und Personen, die eine ausgeprägte Neigung zum Glücksspiel besitzen oder eine solche entwickeln könnten. Das Verbot trage dazu bei, diese Personenkreise vor der mit problematischem Spielverhalten verbundenen Suchtgefahr und deren möglichen finanzielle Folgen zu schützen. Die Tatsache, dass die Ahnung des Verstoßes wegen des grenzüberschreitenden Charakters des Internets schwierig sei, stehe dem nicht entgegen, da z.B. gegenüber den Server-Betreibern und den Dienstleistungsunternehmen, die die finanziellen Transaktionen abwickeln, wirksame Maßnahmen in Betracht kämen.
- Pressemitteilung Nr. 45/2011 des BVerwG vom 01.06.2011
- Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)
Vorinstanz:
- AG Ansbach, Urteil vom 9.12.2009 – AN 4 K 09.00570 und VG AN 4 K 09.00592