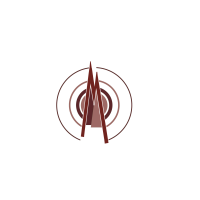Das von Professor Karl-Nikolaus Peifer herausgegebene Lehrbuch "Schuldrecht - Gesetzliche Schuldverhältnisse" ist nun in der 8. Auflage beim Nomos Verlag erschienen. In dem Lehrbuch werden die Gesetzlichen Schuldverhältnisse aus unerlaubter Handlung, ungerechtfertigter Bereicherung und Geschäftsführung ohne Auftrag systematisch und verständlich anhand von klassischen und aktuellen Fallbeispielen aufbereitet. In der aktuellen Auflage wurden aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise die Auswirkungen des AI-Acts auf die deliktische Haftung, neue BGH-Rechtsprechung zum Schockschaden sowie Neuerungen zur Produkthaftung bei Software berücksichtigt.
Das Werk bietet mit der Kombination aus abstrakten Erläuterungen, Fallbeispielen, methodischen Hinweisen und rechtvergleichenden Einordnungen eine verlässliche Grundlage für Studium, Referendariat und Praxis.
Aktuelle Meldungen
Lehrbuch "Gesetzliche Schuldverhältnisse" in 8. Auflage erschienen!

2. Kölner Symposium zum Urheber- und Medienrecht
Das 2. Kölner Symposium zum Urheber- und Medienrecht bot nicht nur mitreissende Blicke vom Köln Sky Tower auf Dom und City-Skyline, sondern ebenso mitreissende Vorträge und Diskussionen zu brandaktuellen Fragen des Urheber- und Medienrechts.
Mehr als ein dutzend hochkarätige Referent:innen boten Einblick in die neueste Rechtsprechung des BGH-Presse- (Vera von Pentz) und des Urhebersenats (Prof. Dr. Thomas Koch). Ein Themenschwerpunkt war die urheber- und äußerungsrechtliche Behandlung von KI. Prof. Dr. Anna K. Bernzen gab den Teilnehmern einen analytischen Überblick über die weltweiten urheberrechtlichen Klagen gegen die Betreiber von KI-Modellen, die offenbarten, dass gerade in regulierungsschwachen Staaten, wie den USA oder China, keinesfalls beliebige Freiheiten der Werknutzung in solchen Modellen bestehen. Dr. Kai Welp ergänzte dies um einen spannenden Einblick in die Klagen der GEMA gegen OpenAI, die vor dem Landgericht München verhandelt wird (https://lnkd.in/euTzi6we) und weitere Verfahren. Jan Bernd Nordemann fügte der Diskussion einen Vorschlag zur zivilrechtlichen Verfolgung der in Art. 53 der KI-Verordnung enthaltenen urheberrechtsbezogenen Organisationspflichten hinzu. In der anschließenden Diskussion überwog die Einsicht, dass Kooperationsmodelle schon zur Erhaltung der Rechtssicherheit für die Entwickler und Betreiber der Modelle aussichtsreich sind, allerdings auch vom Erfolg individueller Klagen abhängig sind. Die Verwertungsgesellschaften können über die Bündelung solcher Klagen die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern, müssen dafür aber ihre klassischen Wahrnehmungsstrategien erweitern. Die GEMA zeigt, dass dies möglich ist. Der erste Abend endete mit einem gemeinsamen Abendessen über den Dächern von Köln - bereichert nun um den Blick aus den Wolken auf den abendlich beleuchteten Dom.
Der zweite Tag war zunächst dem Urheberrecht gewidmet. Aus dem Rechtssprechungsbericht von Prof. Dr. Thomas Koch entspann sich eine Diskussion über den Werkbegriff des Urheberrechts. Wie wichtig der menschliche-persönliche Einfluss auf die Schöpfung im KI-Zeitalter ist, legte Prof. Dr. Benjamin Raue (Uni Trier) akribisch anhand der EuGH-Rechtsprechung und der Schlussanträge in den EuGH-Fällen Mio und Konekta (C‑580/23 und C‑795/23) dar. Fasziniert waren die Teilnehmenden von dem Vortrag des ehemaligen Generalanwalts Henrik Saugmandsgaard Øe, der einen Insiderblick in die Arbeitsweise des EuGH gab und erklärte, warum manche deutsche Idee die Vogelperspektive des EuGH nicht erreicht.
Der Nachmittag widmete sich Deepfakes auf Plattformen. Lea Katharina Kumkar gab den Impuls. Ein Panel aus Regulierern (Julia M., BNetzA; Leonhard Weitz, DG-Connect), Vertretern von Plattformen (Dr. Moritz Holzgraefe) und HateAid (Katharina Goede) diskutierte kontrovers und spürte manche Lücken in DSA, KI-VO und Praxis auf, die zeigen, dass es genügend zu diskutierten gibt beim 3. Kölner Symposium Urheber- und Medienrecht in 2026 mit Wolters Kluwer und CBH Rechtsanwälte.
17. Jahresveranstaltung des kölner forum medienrecht e.V.
Die diesjährige Jahresveranstaltung des kölner forum medienrecht widmet sich den aktuellen Herausforderungen rund um die Regulierung generativer KI. Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Praxis. Professor Karl-Nikolaus Peifer wird auch in diesem Jahr durch die Veranstaltung führen und außerdem einen Dialog zum Thema „Demokratiegefährdung durch Deepfakes“ zwischen JProf. Dr. Lea Katharina Kumkar (Institut für Recht und Digitalisierung Trier) und Felix Mai (Chefjustiziar, ZDF) moderieren. Der Tag bietet ein vielseitiges Programm mit Impulsvorträgen, Keynotes und Podiumsdiskussionen. Die Teilnahme ist mit Anmeldung kostenfrei möglich. Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier: https://koelner-forum-medienrecht.de/veranstaltungen/17-jahresveranstaltung-2025/
Alle Informationen im Überblick:
Thema:
Generative Künstliche Intelligenz – Regulierung braucht doch keiner?!
Datum & Ort:
30. Oktober 2025, 9:30 – 17:30 Uhr
Ratssaal im Kölner Rathaus (Spanischer Bau)
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Regulatorische Ansätze in der EU und den USA
- Die Balance zwischen freiem Wettbewerb und Regulierung
- Deepfakes und ihre Gefährdung der demokratischen Ordnung
- Schutz von Persönlichkeitsrechten bei kreativer Nutzung
- Kollektive Wahrnehmung von Verwertungsrechten im KI-Zeitalter
Anmeldung:
Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung über folgende Plattform: pretix: https://pretix.eu/kfm/kfm/
Über das kölner forum medienrecht:
Das Kölner Forum Medienrecht entstand 2007 auf Initiative der Stadt Köln in Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln, der Deutschen Medienakademie sowie der Kanzlei FREY Rechtsanwälte.
Als gemeinnütziger Verein organisiert das kölner forum medienrecht vor allem Veranstaltungen zu aktuellen Fragen des Medienrechts und der Regulierung. Damit bietet es eine Plattform zum Austausch für Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie politische Entscheidungsträger:innen. So entstehen Räume, in denen unterschiedliche Perspektiven zusammenfließen, Wissen gebündelt und praxisnahe Lösungsansätze diskutiert werden können.
Die jährlichen Veranstaltungen bieten fundierte Informationen, hochwertige Diskussionen und stärken damit die Medienwirtschaft und Medienwissenschaft sowie die Sichtbarkeit und Attraktivität des Medienstandorts Köln und der gesamten Region.
Sommerfest der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
Wir freuen uns sehr, dass das Sommerfest der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, welches sich jedes Jahr zu Recht großer Beliebtheit erfreut, wieder stattfinden kann und so die Tradition weitergeführt wird.
Zu kalten Getränken, Würstchen (auch vegan) und einem regen Austausch lädt die Rechtswissenschaftliche Fakultät Studierende, Professorinnen und Professoren, Beschäftigte, Alumni und Freunde der Fakultät ein. Musikalisch begleitet uns wieder DJ Mathias Gallas. Den beständigen Erfolg unseres Festes verdanken wir an erster Stelle der Rechtsanwaltskanzlei GÖRG, die freundlicherweise auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl unserer Gäste sorgt.
Das diesjährige Sommerfest findet am 25. Juni 2025 von 18.00 bis 22.00 Uhr auf der Rückseite des Hörsaalgebäudes statt.
Wir freuen uns schon auf einen fröhlichen Abend bei hoffentlich gutem Wetter!
Jährliche Veranstaltung des Justizvollzugsbeauftragten NRW
Vollbericht von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer:
Medienarbeit und Vollzugsdienst - reaktiv oder aktiv?
Am 2.12.2024 fand in der Universität zu Köln die jährliche Veranstaltung des Justizvollzugsbeauftragten NRW, Prof. Dr. Michael Kubink statt. Anwesend waren der Justizminister des Landes Dr. Benjamin Limbach, Gerichtspräsidenten, Leitungspersonen der Staatsanwaltschaft sowie Verantwortliche der Justizvollzugsanstalten. Diskutiert wurde über die Frage, ob die Medienarbeit der JVAs, "gut aufgestellt" ist.
Nach einem Grußwort des Ministers und einer Einführung von Michael Kubink äußerte Dr. Carolin Springub, die in ihrer Dissertation "Strafvollzug und Öffentlichkeit" (https://lnkd.in/gdukaJrd) "Überlegungen zu einem kommunizierenden Strafvollzug" angestellt hatte, Zweifel. Sie empfahl eine proaktive Medienarbeit, provokant den Einsatz "vollzuglicher Influencer", um den Alltag in den JVAs anschaulich und realistisch darzustellen.
Sie erhielt Zuspruch aus der Praxis. Uwe Nelle-Cornelsen (NRW-Justizministerium) und Angela Wotzlaw (JVA Köln) ergänzten, dass es zahlreiche Projekte bereits gebe, auch solche, die in Zusammenarbeit mit den etablierten Medien erfolgten, etwa dem Tatort Münster, der in der JVA Köln gedreht wird.
Der bayerische Tatort "Wunderkind" lieferte einen Anlass für das diesjährige Tagungsthema. Ihm wurde von den Praktikern des Justizvollzuges nahezug einhellig vorgeworfen, den JVA-Alltag einseitig, verzerrt und fehlerhaft darzustellen. Der eingeladene Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stiller verteidigte sich persönlich und verwies auf seine künstlerischen Freiheiten, die auch Überspitzungen zuließen. Er bezweifelte, dass der Tatort als Abbild der Realität wahrgenommen werde, obgleich er in einem Interview den selbst gesetzten Anspruch formuliert hatte, dass "diese Welt realistisch, glaubwürdig und in ihrer Härte zu zeigen, ... mir wichtig (war)" (https://lnkd.in/gJPy7Trr).
Ich wies in meinem Vortrag darauf hin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Programmauftrag habe, der auch in der Unterhaltung ein eigenes Profil zeigen und Stereotype vermeiden solle (§ 26 I 9 MStV). Das erlaubt zwar keine subjektiven Zuschaueransprüche, betont aber die Last, ein selbstformuliertes Verständnis von Realitätsnähe auch einzulösen. Diese Einlassung hörte Stiller leider nicht mehr, weil er nach seinem Statement die Veranstaltung übereilt verlassen hatte. Die Gelegenheit zum Diskurs verstrich. Aktive Medienarbeit hat offenbar Grenzen, wenn sie auf einen solchen Diskurs vertraut.
Besser man macht die Medienarbeit selbst: Das zeigten die Macher:innen des Formates "Podknast", die mit JVA-Insassen kurze Filme über den Alltag in der JVA drehen und auf diese Weise "sagen, was ist" (so die Eingangsforderung von Michael Kubink). Insgesamt ein gelungenes Format, das zeigt, dass die Medienarbeit der Justiz zwar an Finanzierungs- und Leistungsgrenzen stößt, den Auftrag zur aktiven Information aber verstanden hat.
Besonders interessant war der Blick auf die Rechtsprechung in den Nachbarländern. Er offenbarte, dass die Gerichte bei der Abgrenzung von Kunst und Design weitgehend auf sich allein gestellt sind. Die vom EUGH gewünschte Harmonisierung des Werkbegriffs tritt auf der Stelle.
Zur Veröffentlichung auf LinkedIn (hier)
1. Kölner Symposium Urheber- und Medienrecht
Vollbericht von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer:
Klarer Ausblick am Ende des 1. Kölner Symposiums Urheber- und Medienrecht! (veranstaltet von Wolters Kluwer) am 25.11./26.11. im SkyTower in Köln, geleitet von Prof. Dr. Jan F. Orth, Prof. Dr. Ingo Jung, Prof. Dr. Benjamin Raue und meiner Person. Was gab es? Prof. Dr. Thomas Koch, Vors. 1. Senat des BGH, warf einen umfangreichen Blick auf die Entscheidungen im Urheberrecht. Besonders anregend waren die Diskussionen zu den Urteilen "Fototapete" und "Panoramafreiheit". Prof. Michael Schwertel führte anschließend in einem atemberaubenden Vortrag die Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit moderner KI-Systeme, insbesondere im Bereich von Bild- und Videoerstellung vor. Die Wolken am Kölner Himmer wurden vorübergehend dystopisch dunkel. Prof. Dr. de la Durantaye zeigte, wie schwierig die Lösung der Vergütungsfragen ist, weckte aber einen Hoffnungsschimmer bei der Behandlung von Output-Daten. In einer anschließenden von Benjamin Raue moderierten Diskussion mit Prof. Dr. Stefan Sporn, Tatjana Anisimov und Anna Lissner überwog der Optimismus in Bezug auf die Möglichkeiten für den Produktionsprozess. Allerdings gab es auch Zweifel, ob das Rechtemanagement gelingen wird, ob Transparenz hilft und der Datensatz immer ausreichend qualitativ gehalten werden kann.
Beim Abendessen vor der nächtlichen Skyline der Rheinmetropole versöhnten sich auch hitzig gewordene Debattant:innen.
Am zweiten Tag gab es einen ebenso sorgfältigen wie systemschaffenden Vortrag von Prof. Dr. Franz Hofmann zur EuGH-Rechtsprechung im Urheberrecht. Dr. Martin Bittner vom Bundesjustizministerium erläuterte die Arbeit seines Hauses, das die Entwicklungen um die Vergütungsproblematik im Urheberrecht (auch mit Sorge) beobachtet. Noch vor der Mittagspause berichtete Vera von Pentz, stv. Vors. 6. Senat des BGH, sehr anschaulich über die Entwicklungen im Äußerungsrecht. Schwerpunkte waren Privatphäreschutz und Grenzen der Selbstöffnung, prozessuale Fragen der Kernbereichstheorie und Herausforderungen der Verdachtsberichterstattung. Auch eine "me-too"-Problematik wurde behandelt. Der Tag endete mit einer Debatte zur Frage, wie Gerichte und Staatsanwaltschaften (Prof. Dr. Jan F. Orth), Rundfunk und Presse (Dr. Nima Mafi-Gudarzi) sowie Anwält:innen (Chan-jo Jun) in einer veränderten Medienlandschaft handeln. Ergebnis: Komplexe Rechtsfragen müssen präziser und proaktiver kommuniziert werden. Die Anwaltschaft hat die größten Freiheiten, auch zur nicht von allen positiv beurteilten Litigation PR (oder auch PR durch Litigation), die Medien haben Freiheiten, aber auch dichte Sorgfaltspflichten, was Zuspitzung erschwert, die Gerichte haben es am schwersten. Rahmenregelungen und Ausstattung sind auf eine reaktive und defensive Informationspolitik zugeschnitten. Das mag künftig nicht mehr genügen, um der hochinteressierten Gesellschaft die Komplexität des Rechts transparent und verständlich zu vermitteln. Viele Fragen beantwortet, manche Wolken bleiben (aber auch ein Lichtreflex auf der linken Domspitze).
Und unsere juristische Innensicht in der Schlussdebatte wurde sanft, aber präzise von Dr. Iris Heilmann auf den Ausgangspunkt geleitet: Komplexität muss man gelegentlich auch in 30 Sekunden vermitteln, wenn man mehr Zeit nicht bekommt. Das verdient eine Extraerwähnung!
Zur Veröffentlichung auf LinkedIn (hier)
16. Jahresveranstaltung des kölner forum medienrecht e.V.

Am 28. Mai 2024 fand die 16. Jahresveranstaltung des kölner forum medienrecht e.V. zusammen mit dem Grimme-Forschungskolleg der Universitat zu Köln im Rathaus der Stadt Köln statt. Die Veranstaltung widmete sich unter der Leitung von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer dieses Jahr dem Thema „Urheberrecht und Künstliche Intelligenz (KI)". Nach einer Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin Henriette Reker via Videobotschaft, wurden dem Publikum zahlreiche Vorträge und Diskussionsrunden geboten, die sich thematisch u.a. mit den Möglichkeiten und Auswirkungen von Kl für kreativ Arbeitende, den Herausforderungen des Urheberrechts bei der Verwendung von Kl und den rechtlichen und gesellschaftspolitischen Problemfeldern von Kl und Kreativität in beeindruckender Weise auseinandersetzten.
Ein großer Dank geht deshalb an Prof. Michael Schwertel (CBS International Business School), Matthias Hornschuh (Komponist fur Film- und Horspielmusik und Musikproduzent in Koln), Corinna Kamphausen (Geschäftsführerin Eyes & Ears of Europe), Michael Zschiesche (Geschaftsführer der Klimek Schneider GmbH), Oliver Hinz (Journalist und Gründer von haushinzki.de), Prof. Dr. Katharina de la Durantaye (FU Berlin), Prof. Dr. Martin Senftleben (Universität Amsterdam), Sandra Freischem (Rechtsanwältin, VG BildKunst), Prof. Dr. Dieter Frey, LL.M. (FREY Rechtsanwälte), Dr. Christian Meyer-Seitz (BMJ, Abteilung III: Handels- und Wirtschaftsrecht), Dr. Christine Jury-Fischer (Geschäftsführerin der Verwertungsgesellschaft Corint Media GmbH), Katharina Uppenbrink (Geschaftsführerin der Initiative Urheberrecht), Tabea Rößner, MdB (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) (Vorsitzende des Ausschusses für Digitales im Bundestag), Andrée Haack (Dezernent für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales), Prof. Dr. Maximilian Becker (Universitat Siegen), Dr. Erik Weiss (Universitat zu Koln) und allen anderen Anwesenden.
Ein Tagungsbericht von Frau Wiss. Mit Ch. Schmitz findet sich hier.
28. Mai 2024 – Tagung: Urheberrecht und KI
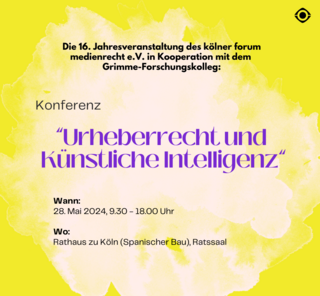
Die Tagung findet im Rathaus der Stadt Köln statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.
Aufgrund des hohen Andrangs stehen leider nur noch wenige Plätze zur Verfügung.