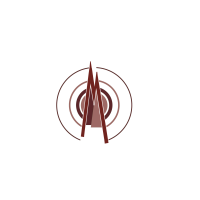Zerreißprobe der deutschen Verwertungsgesellschaften

Von Camilla Kling, wissenschaftlicher Mitarbeiterin und Geschäftsführerin des Instituts für Rundfunkrecht an der Universität zu Köln
Seit geraumer Zeit schwelt es in der historisch gewachsenen Zusammenarbeit zwischen Urhebern, Verlagen und ihren Treuhändern, den Verwertungsgesellschaften. Die für eine angemessene Vergütung notwendige Symbiose droht zu bröckeln. Hintergrund ist eine wahrnehmungsrechtliche Besonderheit im System der Verwertungsgesellschaften: Weil in ihnen sowohl Urheber wie Verlage mit jeweils unterschiedlichen Interessen vereint sind, bezeichnet man Verwertungsgesellschaften auch als „nicht gegnerfrei“. Sie sehen sich der komplexen Aufgabe gegenüber, konfligierende Belange ihrer vielzähligen Wahrnehmungsberechtigten nicht nur intern, sondern auch im Außenverhältnis existenzsichernd für die Urheber (§ 11 S. 2 UrhG) im Gleichgewicht zu halten. Über eine das Innenverhältnis betreffende Problemstellung der Vergütungsausschüttung hatten jüngst die Gerichte zu entscheiden; und auch die Politik interessiert sich für die – nicht zuletzt aufgrund der Harmonisierungsbestrebungen der Union auf europäischer Ebene relevante – Ausschüttungspraxis der Treuhänder-Gesellschaften: Derzeit (noch) erhalten Verleger lediglich aufgrund des Verteilungsplans eine pauschale Beteiligung an den Vergütungen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen der Urheber. Jetzt setzte der BGH mit Beschluss vom 18.12.2014 das letztinstanzliche Verfahren aus, um die Entscheidung des EuGH in einem ähnlich gelagerten belgischen Fall abzuwarten; der Cour d’appel de Bruxelles legte ihm die Frage vor, ob Regelungen der einschlägigen Richtlinie 2001/29/EG es den Mitgliedstaaten gestatten, „die Hälfte des gerechten Ausgleichs für die Rechtsinhaber den Verlegern der von den Urhebern geschaffenen Werke zu gewähren, ohne dass die Verleger in irgendeiner Art und Weise dazu verpflichtet wären, den Urhebern zumindest indirekt einen Teil der Entschädigung, der ihnen vorenthalten wird, zugutekommen lassen“.
Ein Überblick über das dem Streit zugrunde liegende Problem soll Denkanstöße liefern. Warum das für (junge) Wissenschaftler allgemein – und nicht nur Urheberrechtler – von Bedeutung ist: Die konkret betroffene VG Wort ist auch hinsichtlich der Publikationen des akademischen Nachwuchses der maßgebliche Ansprechpartner in Fragen der Vergütung abseits von Autorenhonoraren. Sie gewährleistet nach Anmeldung von gedruckten Aufsätzen und Online-Veröffentlichungen Vergütungsflüsse für die Nutzung unseres geistigen Schaffens. Die Vergütungserlöse fließen allerdings nicht dem Urheber vollständig zu, sie werden bisher um einen pauschalen Abzug zugunsten von Verlagen und Urheberorganisationen (Berufsverbände) gekürzt – Stein des Anstoßes für manchen Urheber, dessen Vergütung dadurch geschmälert wird.
Der Jurist und wissenschaftliche Autor Martin Vogel sah darin eine unrechtmäßige, da willkürliche Beteiligungspraxis der Verwertungsgesellschaft und beanstandete – nach Einschätzung der bisherigen Rechtsprechung zu Recht – entsprechende Regeln im Verteilungsplan Wissenschaft, nach denen den Verlagen unter anderem pauschal bis zu 50 % der Vergütungseinnahmen ausgeschüttet werden – dies waren im Jahr 2013 insgesamt immerhin 29 Mio. Euro. Zwar ist eine grundsätzliche Pauschalierung und Typisierung in Verteilungsplänen bei der Vielzahl an vertretenen Werkschaffenden (ca. 487.000) nach höchstrichterlicher deutscher Rechtsprechung zulässig, allerdings müssen nach Unionsrechtsprechung dem Urheber die Früchte seines Schaffens zukommen (EuGH-Luksan). Grundsätzlich darf also nur derjenige von der Verwertungsgesellschaft eine Leistung erhalten, der auch Leistungserbringer ist, also die entsprechenden Urheber- oder Leistungsschutzrechte innehat: Nach § 7 S. 1 UrhWG hat die Verwertungsgesellschaft gemäß ihrer Treuhandstellung eingezogene Vergütungen an die mit ihr vertraglich gebundenen Rechtsinhaber leistungsgerecht und nach willkürfreien Regeln auszukehren. Da Verlagen nach dem Urheberrechtsgesetz jedoch kein Leistungsschutzrecht zusteht, sind sie zumindest nicht originär Berechtigte. Ein Urheber überträgt seinem Verlag aber bei Abschluss des Vertrages als Teil der Gegenleistung für die verlegerische Leistungserbringung üblicherweise neben den Verwertungsrechten die gesetzlichen Vergütungsansprüche gem. § 63a S. 2 UrhG nF zur Einbringung in die Verwertungsgesellschaft. Schließt er später einen Wahrnehmungsvertrag mit der Verwertungsgesellschaft über eben diese Rechte, so läuft diese Übertragung ins Leere, da das Prioritätsprinzip greift und es einen gutgläubigen Erwerb von Forderungen (mit Ausnahme von § 405 BGB) mangels Rechtsscheinträgers nicht gibt. Im umgekehrten Fall gilt dasselbe. Erfolgte die Abtretung zuerst an eine Verwertungsgesellschaft, so kann der Verlag diese Rechte – und auch solche an künftigen Werken (!), vgl. § 2 Wahrnehmungsvertrag – nicht mehr erhalten und wäre damit konsequenterweise von einer Beteiligung ausgeschlossen. Die VG Wort verlangt bislang jedoch von den Verlagen keinen Nachweis darüber, dass ihnen Vergütungsansprüche überhaupt von den Autoren eingeräumt wurden, die sie wirksam hätten einbringen können. Begründet wird dies mit dem hohen Verwaltungsaufwand, der sich in steigenden Verwaltungskosten niederschlage, die wiederum das auszuschüttende Vergütungsaufkommen reduzierten.
Jahrzehntelang war dies gängige Praxis, die allerdings nie vollkommen akzeptiert war (vgl. bereits UFITA 81 (1978), 348 ff.). Verlage sehen einerseits in ihrer Beteiligung die gerechtfertigte und angemessene Anerkennung ihrer verlegerischen Leistung bei Produktion, Vermarktung und Vertrieb von geistigen Werken, die sich auch monetär widerspiegeln sollte, ohne dass ein Rechtenachweis erforderlich sei. Andererseits befinden kritische Stimmen diese Leistung bereits mit Beteiligungsregelungen im Verlagsvertrag (auf der Stufe Verleger – Urheber) an den Einnahmen aus der individuellen Verwertung für abgegolten. Eine stets wiederkehrende pauschale Beteiligung (auf der Stufe Verleger – Verwertungsgesellschaft) gehe willkürlich auf Kosten der eigentlich Berechtigten, der Urheber. Um also deren Position zu stärken, wurde § 63a UrhG im Zuge der Urheberrechtsreform 2002 neu eingefügt, der die Unverzichtbarkeit und Vorausabtretung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen nur an ihre Treuhänder, die Verwertungsgesellschaft, normiert. Das führte allerdings zu deutlichem Unmut der Verlage, die wegen des Abtretungsverbots keine weitere Beteiligung erhalten hätten, s.o. So drängten sie auf eine neuerliche Gesetzesänderung, die im Jahr 2008 umgesetzt wurde: Ansprüche bleiben gem. § 63a S. 2 UrhG an Verlage abtretbar, aber nur, wenn sie dann durch den Verlag in eine Verwertungsgesellschaft eingebracht werden. Der Streit ist damit aber noch nicht entschieden, vielmehr geht es um die generelle Frage nach der Berechtigung von Verlagen, an den Vergütungseinnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen der Urheber über das System der Verwertungsgesellschaften zu partizipieren.
So steht der Zusammenschluss von Urhebern und Verlagen unter einem Dach auf dem Prüfstand. Verlage sind für ihr Geschäftsmodell auf die geistigen Schöpfungen der Kreativen angewiesen. Gleichzeitig benötigen Urheber die Verlage als verhandlungsmächtigere Partner in den Auseinandersetzungen um angemessene Vergütungshöhen bspw. mit Geräteherstellern innerhalb einer Verwertungsgesellschaft. Dieses Abhängigkeitsverhältnis wird verkompliziert durch nicht immer gleichlaufende Interessen: Verlage als Verwerter sind oftmals in der wirtschaftlichen Gegenposition; und doch vereint in einer Verwertungsgesellschaft. Möglicherweise ist eine Anpassung dieses teils über 100 Jahre bestehenden Arrangements an die Gegebenheiten der heutigen Zeit notwendig.
Würde man sich also behelfen, indem Verlage künftig ausgeschlossen würden? Ein Blick in die historische Entwicklung von Verwertungsgesellschaften zeigt: Die österreichische Genossenschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger entstand bereits 1897 und schloss sich 1930 mit der deutschen Genossenschaft Deutscher Tonsetzer (1903) und der Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte (1915) zum „Musikschutzverband“ zusammen, der „Mutter“ der GEMA. Die Verleger waren also gewissermaßen von der Geburtsstunde der kollektiven Rechtewahrnehmung an dabei, gleichsam „Geburtshelfer“ (Schack). Solche ein Jahrhundert alte Strukturen aufzubrechen, ist ohne großen (gerichtlichen) Knall schwer möglich. Das Argument gegen eine Aufrechterhaltung der Beteiligung von Verlagen wurde bereits angedeutet: Verwertungsgesellschaften sollen als „quasi-gewerkschaftlicher“ Zusammenschluss im besten Sinne der Rechtsinhaber tätig werden. Das würde behindert durch gegenläufige Interessen der Verlage. Dem wird entgegnet, Urheber und Verlag hätten sehr wohl ein einendes gemeinsames Interesse: Ohne beider Beiträge sei die wirtschaftliche Wertschöpfung aus dem endgültigen Werk unmöglich. Dieser Umstand mag dazu führen, dass sie sich nicht gegenseitig schädigen. Der Beitrag des Verlegers ist auch nicht zu vernachlässigen, denn er ermöglicht gewissermaßen erst das Entstehen eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs; seine pauschale Beteiligung unter Berufung auf das Leistungsprinzip, ohne einen Nachweis der Rechtsinhaberstellung führen zu müssen, kommt dennoch einer Fiktion eines Leistungsschutzrechts für Verlage allzu nahe. Dies erscheint als falscher Weg, der letztlich zu Unfrieden führt und seinerseits die Kulturwirtschaft hemmt. Würde man allerdings das gegenseitige Zusammenwirken noch weiter aufspalten und je eine Verwertungsgesellschaft für Autoren und Verlage verlangen, schrumpfte die Verhandlungsmacht der Urheber gegenüber Verwertern wohl in kaum tragbaren Maße. Die Auswirkungen sind ungewiss.
Drei mögliche Alternativen sollen aufgezeigt werden:
- Nach dem Leistungsprinzip sind zwar auch Verlage für ihren Beitrag an der Werkveröffentlichung zu beteiligen. Allerdings nur dann, wenn sie Berechtigte i.S.v. § 1 UrhWG, also Inhaber vom Urheber abgetretener Ansprüche sind. Sind sie es nicht, käme eine entsprechende Beteiligungsregel im Verlagsvertrag in Betracht, was allerdings die generelle Abtretbarkeit von Vergütungsansprüchen auf Verlage voraussetzt. Erachtet man sie auch nach Luksan (s.o.) für zulässig, wird sich der jeweilige Verlag jedoch häufig in einer besseren Verhandlungsposition befinden, der der Urheber ohne kollektive Unterstützung wenig entgegnen kann. Dieser Weg erscheint daher nicht zielführend.
- Ursache des Problems ist das Prioritätsprinzip. Entscheidend für seine Anwendung ist, ob es Wege gibt, seine Geltung zu meiden. Diesbezüglich behilft sich das LG Berlin mit einer engen Auslegung des Wahrnehmungsvertrags: Die Wahrnehmung der Rechte durch eine Verwertungsgesellschaft sei „als eine Art eigenständiges Nutzungsrecht zu verstehen, das eine nachfolgende Übertragung von Rechten auf die Verleger nicht ausschließt“. Hiernach würde also nicht ein und dasselbe Recht übertragen (einmal auf die Verwertungsgesellschaft, nachfolgend unwirksam an den Verlag), sondern ein von den ursprünglichen Nutzungsrechten abgespaltenes Wahrnehmungsrecht über diese Nutzungsrechte. Ob dies allerdings in Einklang mit der Rechtsprechung zur (begrenzten) Aufspaltbarkeit von Urheberrechten in Einklang steht, ist fragwürdig.
- Ist aufgrund der Leistung der Verlage eine Beteiligung dennoch zu befürworten, deren Verbleib in den Verwertungsgesellschaften auch für die Urheber wichtig, so ist vor dem Hintergrund der persönlichen geistigen Schöpfung im Vergleich zur Investitionsrisikoübernahme durch den Verlag eine Beteiligung in Höhe von 50 % gleichwohl zu hoch. Denkbar wäre eine legislative Bestimmung zumindest hinsichtlich anzuwendender Bemessungskriterien wie Intensität der verlegerischen Investition, Aufwand in Produktion, Marketing, Vertrieb.
Der Ruf nach einer gesetzgeberischen Reform des § 63a UrhG ist unüberhörbar, doch zunächst wird der Rechtsstreit vor dem BGH im kommenden Jahr nach Entscheidung des EuGH (Rechtssache C-572/13) weiterverhandelt werden.